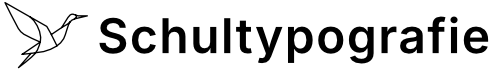Form vor Gefühl – Warum Schrift mehr sagt als sie zeigt
Was macht gute Typografie aus? Und warum kann sie mehr ausdrücken, als man auf den ersten Blick sieht? Eine Spurensuche zwischen Form, Lesbarkeit und Wirkung.
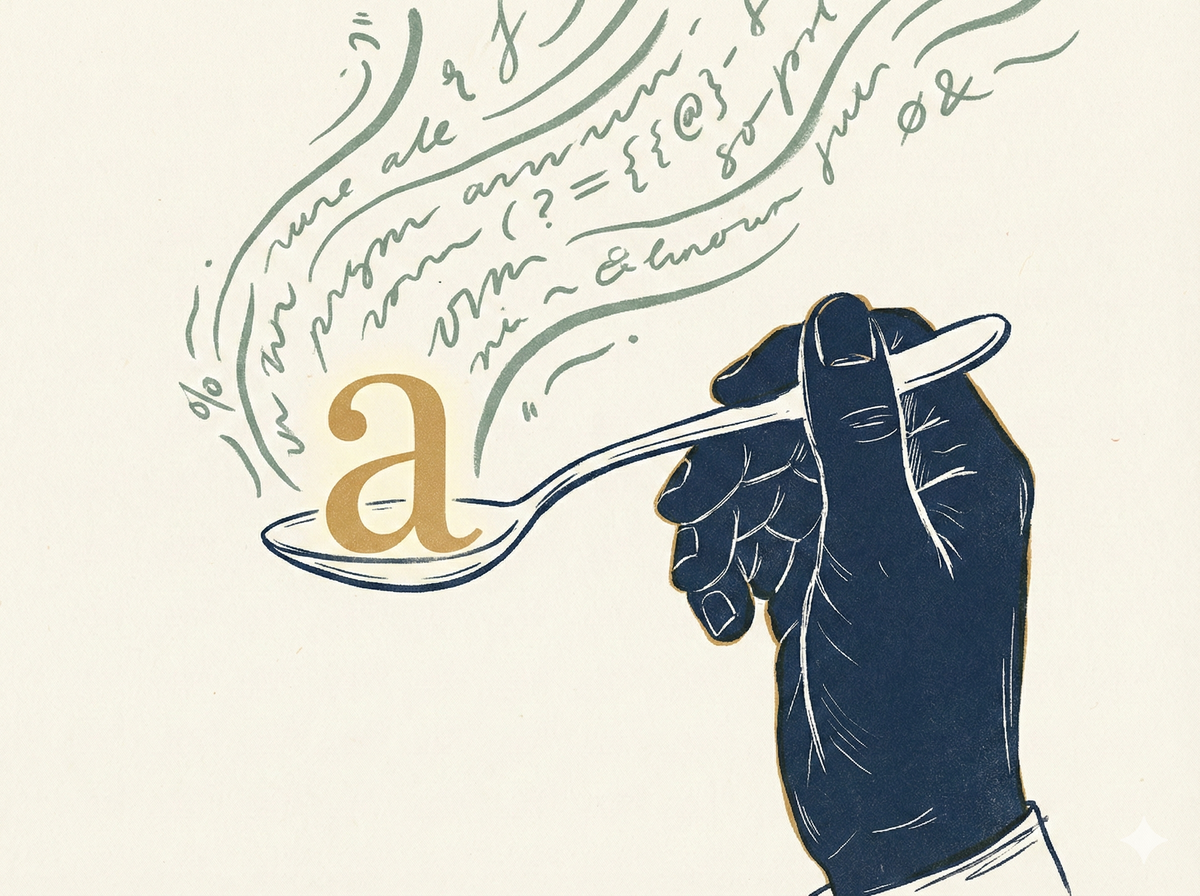
Vor mehr als 22 Jahren bekam ich meinen ersten eigenen Computer. Als Jugendlicher musste ich mich zu dieser Zeit mit einem 100-Mhz-Prozessor und 16 MB (!) RAM zufrieden geben, was nach heutigen Maßstäben verdammt gering ausfällt. Auf dem Rechner lief Windows 98 mehr müßig als brauchbar, aber schon zeitig begann ich damit, mit Word Dokumente zu gestalten. Und ich begann die selben Fehler, die meine Kollegen in der Schule heute noch machen: Ich klickte auf allerlei Schaltflächen, um möglichst viele Funktionen zu nutzen und zu zeigen, dass ich das Programm beherrsche. Ich machte mir aber keinerlei Gedanken über die Sinnhaftigkeit dieser Formatierungen.
Schon recht zeitig besorgte ich mir ein Buch, das heute noch in meinem Regal steht: »Grundkurs Typografie und Layout« von Claudia Runk. Die Informationen in dem Buch saugte ich förmlich wie einen Schwamm auf und lernte, dass es bei der Gestaltung mit Text mehr darauf ankommt, einen lesbaren Text zu produzieren, bei dem mehr der Inhalt im Vordergrund steht und nicht die Gestaltung. Adrian Frutiger brachte zu diesem Thema ein Zitat, das ich gerne und oft zitiere:
»Wenn du dich an die Form des Löffels erinnerst, mit dem du die Suppe gegessen hast, dann war es eine schlechte Form. Löffel und Letter sind Werkzeuge: das eine nimmt Nahrung aus der Schale, das andere nimmt Nahrung vom Papierblatt. Die Schrift muss so sein, dass der Leser sie nicht bemerkt.«
Adrian Frutiger
Was meinte er damit? In Adrian Frutigers Zitat ging es im Kontext um die Gestaltung von Schriften, also wenn Typografen eine Schriftart entwerfen. Diese muss so gestaltet sein, dass man sich am Ende nicht mehr daran erinnern kann, wie sie ausgesehen hat, wenn man einen Text in dieser Schrift gelesen hat. Aber wir können hier für uns eine wichtige Erkenntnis ableiten: Wenn ich lese und dann der Lesefluss unterbrochen wird, weil z. B. in der nächsten Zeile ein Wort fett gesetzt ist und das Auge dahin springt, weil dieser Fettdruck meine Aufmerksamkeit erregt, dann wird der Lesefluss unterbrochen. Ich konzentriere mich nicht mehr auf den Inhalt sondern auf die Form meines Textes. Sobald ich anfange, über die Gestaltung nachzudenken statt mich auf den Inhalt zu konzentrieren – so die Schlussfolgerung –, dann habe ich einen Text schlecht gesetzt. Primäres Ziel sollte es also sein, einen Text so zu setzen, dass man sich vorrangig auf den Inhalt konzentriert.
Typografie und Schule
Typografie als Handwerk, bei dem es darum geht, einen Text situativ passend zu setzen, umgibt uns in sehr vielen Situationen. Als Lehrer bin ich ständig mit Informationen im Umgang, die ich meinen Schülern vermitteln möchte. Manches Mal muss ich auch meine Schüler abfragen und sie müssen dabei genau verstehen, was ich von ihnen möchte. Hier kommen Typografie und Layout ins Spiel: Ich bereite diese Informationen so auf, dass meine Schüler die Inhalte möglichst störungsfrei konsumieren können. Das ist eine leicht dahingesagte Aussage, die sich aber aufgeschlüsselt als eine unglaublich komplexe Aufgabe offenbart. Bei der Gestaltung spielen Faktoren wie z. B. Lesbarkeit, Layout/Farbwahl und Emotionen eine entscheidende Rolle, die hier nur in Ansätzen angerissen werden können. Idealerweise werden wir uns hier auf dem Blog langfristig mit der Gesamtthema auseinandersetzen, aber schauen wir uns die erwähnten Bereiche einmal genauer an:
Lesbarkeit. Die Lesbarkeit ist das primäre Ziel bei der Textgestaltung. Lesbar wird ein Text einerseits durch die Schriftart selbst, deren Gestaltung sich in ihrer Größe, Farbe, Wort- und Zeilenabstand und der Form selbst zeigt. Hier gibt es verschiedene Richtlinien, an denen man sich je nach Kontext orientieren kann, aber im Grunde sollte die Schrift eine lesbare Schriftgröße haben, die Schriftfarbe sollte einen guten Kontrast zum Hintergrund aufweisen, die Schriftzeichen nicht zu gedrängt oder weit auseinander stehen und das Auge sollte nicht zu weit in die nächste Zeile springen müssen, um ein Zurückrutschen in die selbe Zeile zu verhindern, was durch einen angemessenen Zeilenabstand erreicht wird. Doch welche Werte nimmt man hier genau? Welche Schriftgröße wähle ich, welche Farbe, Wort- und Zeilenabstand sind konkret zu bevorzugen? Hier kann man leider nur sagen: Es hängt davon ab. So sagt man beispielsweise, dass eine Zeile nicht größer als 80 oder 90 Zeichen lang sein sollte. Aber schaut man auf eine gedruckte Zeitung, wird dieser Wert in den schmalen Absätzen weit unterschritten, das durch die Form der Schrift selbst kompensiert werden kann. Die Schriftart »Times« (von der die Variante »Times New Roman« abgeleitet ist) wurde speziell für die gleiche namensgebende Zeitung entworfen, die so gestaltet ist, dass sie auf schmalen Absätzen besonders gut lesbar ist, weniger aber in Hausarbeiten, die sich über eine Blattbreite DIN A4 drängt. Und auch in der Schriftgröße gibt es Unterschiede: Eine »Times New Roman« als Schrift ist kleiner als eine »Arial«, weshalb es sich anbietet, die Schriftgröße der »Times New Roman« bei DIN A4 auf 12 Punkt zu setzen, aber eine »Arial« eher auf 11 Punkt. Es gibt vieles, das man zur Lesbarkeit von Texten und darüber sagen könnte, wie diese gestaltet sein sollten; der Absatz sollte aber gut aufgezeigt haben, dass mehr als einige pauschale Aussagen als Faustregel dazu gehört. Der Kontext bestimmt das Gesamtbild und wir werden uns auf diesem Blog noch genauer damit auseinandersetzen.
Layout/Farbwahl. Diese beiden Bereiche wurden schon im vorherigen Absatz angesprochen. Die Absatzbreite und der Zeilenabstand tragen zur Lesbarkeit eines Textes fundamental bei; auch sollte die Farbe so gewählt sein, dass sie sich vom Hintergrund gut abhebt, wenn sie lesbar sein möchte. Doch manchmal ist das nicht gewünscht – eine hellere Schrift kann ruhiger und sanfter wirken, als ein starker Kontrast von Schwarz/Gelb. Es hängt davon ab, was ich mit meinem Text für eine Botschaft transportieren möchte. Verträge sind manchmal so gestaltet, dass unliebsame Klauseln lieber versteckt und unauffällig ihr Dasein auf dem Blatt Papier fristen. Als Lehrkraft möchte ich aber vielleicht ein wichtiges Detail hervorheben, eine Warnung im Chemieunterricht beispielsweise. Ein gelbes Warndreieck und eine rote Schrift symbolisieren den Lernenden, das diese Informationen für sie bedeutsam und wichtig sind, weshalb sie in ihrer Formatierung vom Standard abweichen. Mehr noch als das: Wir appellieren mit psychologischer Aktivierung an ihr Unterbewusstsein. Der Kontrast von Schwarz und Gelb ist in der Natur fest verankert und warnt Lebewesen voreinander vor Gefahren. Bienen und Wespen warnen mit ihren schwarz-gelben Farben davor, ihnen zu nahe zu kommen, da sie sonst angreifen; den Giftstachel haben die meisten von uns sicherlich schon zu spüren bekommen. Es ein in unserem Unterbewusstsein tief verankertes Muster, auf das wir als Gestalter gezielt zurückgreifen können, um vor Gefahren in unseren Texten zu warnen. Hierbei bewegen wir uns im Bereich der »Farbpsychologie«, die sich mit der Wirkung von Farben in bestimmten Kulturkreisen auseinandersetzt.
Emotionen. Mit Farben können, wie wir gesehen haben, bestimmte Emotionen geweckt werden. Gelb/Schwarz oder Rot wurden als Gefahren angeführt, doch über die Farben hinaus kann ein Text eine bestimmte Stimmung beim Leser erzeugen. Und dies macht die Gestaltung von Text so spannend: Er kann schon wirken, bevor wir ihn überhaupt gelesen haben. Eine kantige und fette Schrift wirkt laut, eine zarte und feine Handschrift dagegen vermittelt Nähe und Empathie. In der Pädagogik kann diese Wirkung gezielt genutzt werden, um z. B. bei einer Konfliktlösung Offenheit und Gesprächsbereitschaft zu signalisieren. Eine Übersichtstafel zu Klassenregeln profitiert von Schriftarten, deren Formen klar geometrisch gehalten sind. Die Form einer Schrift transportiert also Emotionen, die wir gezielt aktivieren können, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Dazu ist es hilfreich, dass man verschiedene Schrifttypen kennt, die sich alle in ihrer Form unterscheiden; die konkrete Gestaltung einer Schrift und ihrer Details macht sie einzigartig, dennoch lassen sich Schriften in verschiedene Gruppen kategorisieren. Und auffällig ist hierbei, dass eine ganze Gruppe an Schriften geeignet ist, eine bestimmte Emotion zu vermitteln. Eine sogenannte serifenlose Schrift (oder auch »Groteskschrift«) wie z. B. die »Arial« wirkt streng, distanziert, aber auch professionell, weswegen sie Vertrauen beim Leser wecken kann. Eine »Comic Sans« wirkt dagegen verspielt, kindlich und locker, aber auch unseriös und unprofessionell. Wenn ich dann eine Abschlussprüfung in dieser Schrift setze, geht jegliche Ernsthaftigkeit verloren und kann den Inhalt gar ins Lächerliche ziehen.
Fazit
Was dieser Text gezeigt hat: Die Gestaltung von Text hat es sich zum vorrangigen Ziel gesetzt, einen lesbaren Inhalt zu erzeugen. Aber allein schon dieser Anspruch ist unheimlich komplex und unterliegt verschiedenen Faktoren, über die wir uns künftig auf diesem Blog beschäftigen möchten. Einen wichtigen Hinweis möchte ich an dieser Stelle jedoch geben: Es gibt viele Regeln, an die man sich in der Typografie halten kann, um einen Text passend zu gestalten, und es ist wichtig, dass man sie kennt. Denn nur, wenn man die Regeln kennt, kann man sie bewusst brechen.
Literatur
Im Text wurde konkret folgende Literatur angesprochen:
- Runk, Claudia: Grundkurs Typografie und Layout. Für Ausbildung und Praxis. Bonn: Galileo Press 2006.