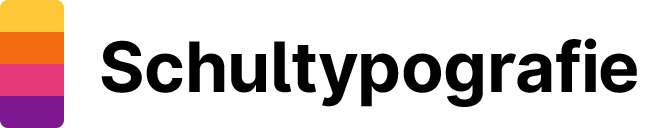Und plötzlich ist wieder alles wie früher
Ich mochte Fußball nie – bis die EM kam. Was als Experiment begann, wurde zur emotionalen Reise: Schüler fieberten mit, Fremde feierten vereint. Ein Sommermärchen voller Begegnungen, das zeigte: Miteinander statt Gegeneinander kann funktionieren – wenn wir es zulassen.

Ich hasse Fußball. Eigentlich. Aber seit ich als Lehrer vor allem mit jüngeren Schülern an einer Haupt- und Realschule zusammenarbeite, sehe ich die Dinge anders. Man überdenkt seine eigenen engstirnigen Ansichten und versucht, sich in die Lebenswelten der Schüler hineinzuversetzen – so geht es mir zumindest.
Mir war klar: Die EM im eigenen Land wird ein besonderes Ereignis sein, darauf stellte ich mich innerlich ein. Ich könnte natürlich den Miesepeter spielen und den mahnenden Finger erheben: ehrliche Arbeit und ehrlich verdientes Geld – was verdient der einfache Mensch im Vergleich zu einem Fußballspieler in 90 Minuten? Generell gibt es viele ethische Baustellen im Fußball, die man kritisch besprechen könnte, aber mir war schnell klar, dass man dieses Ereignis stattdessen für den Zusammenhalt in der Klassengemeinschaft nutzen kann. An meiner Schulform geht Beziehung über Inhalte, wenn man guten Unterricht gestalten möchte. Daher mein Plan: Gemeinsam fiebern wir mit, freuen uns über die Tore oder ärgern uns gemeinsam über verpasste Chancen. All diese Überlegungen bewirkten etwas in meinem Kopf.
Also warf ich sämtliche Vorbehalte über Bord, zog das umstrittene Check24-Trikot an und schaltete den Kopf aus – und meinen TV beim ersten Spiel Deutschland gegen Schottland an. Allein, in meinem Zimmer. Irgendwie freute ich mich auf das Spiel. Irgendwo in meinem Kopf schlummerte die Erklärung meines Nachhilfeschülers zur Abseitsregel, die er mir recht gut erklärt hatte. Sonst wusste ich nicht viel. Klar, der Ball muss ins Eckige – aber ich merkte schnell, dass sich dazwischen so viel mehr abspielte. Das Spiel endete 5:1, und ich war emotional aufgeladen.
Am nächsten Tag wagte ich mich in meinem Check24-Trikot in die Schule. Im Lehrerzimmer gab es erfreutes Lachen und einige Daumen nach oben, aber die Frühaufsicht vor dem ersten Klingeln an der Eingangstür sorgte für viel Erheiterung bei den Schülern. In den darauffolgenden Stunden hörte ich einige Schüler enttäuscht fluchen, dass sie ihr Trikot nicht angezogen hätten – was sich in den Folgestunden änderte. Wir erstellten ein Tippspiel (der Gewinner sollte fünf Drachenzungen-Kratzeis bekommen). Die Stunden bestanden neben dem Unterricht aus interessierten Fragen zu meiner »professionellen« Einschätzung diverser Schiri-Entscheidungen – und ich meine hier nicht einmal das Handspiel im Spiel Deutschland gegen Spanien.
In den Gesprächen mit den Schülern konnte ich vieles rezitieren, was ich in den sozialen Medien aufgeschnappt hatte – das konnte den Schein wahren, dass ich eigentlich (noch) nicht viel vom Fußball verstand. Mein Algorithmus wandelte sich schnell zu Beiträgen zur EM, und ich bekam erst dadurch richtig mit, was sich während dieser Meisterschaft in diesem Land abspielte. Schotten machten München, Köln und Leipzig unsicher. Sie leerten die Bierbestände der Kneipen wie Heuschrecken und hinterließen eine gewaltige Spur aus Liebe und Sympathie – man denke nur an die zwei Schotten, die einer alten Frau im Regen einen Regenschirm über den Kopf hielten. Deutsche feierten mit Schotten Arm in Arm, obwohl wir sie mit 5:1 quasi rasiert hatten – das war echter Sportsgeist: Spaß am Spiel und ein Mehr an Miteinander statt Gegeneinander. Albaner zerbrachen vor den Augen der Italiener Spaghetti, die ihrerseits das Spiel mitspielten; am Ende lagen sich beide Parteien lachend und feiernd in den Armen. Die Niederländer performten eine Mega-Choreografie, die mit einem Sprung nach links und rechts die Laune ins Unermessliche steigerte.
In Leipzig wurde Oma Gerda beim Public Viewing zum Star des Geschehens: Alles begann damit, dass sie immer wieder eingeblendet wurde. Nach und nach wurde dies von der Menge mit Jubel quittiert – und wenn sie nicht zu sehen war, wurde gebuht. So ging es eine ganze Zeit lang, bis sie nach dem Spiel auf die Bühne gehoben und gefeiert wurde. Ihre Worte waren wichtig und richtig: »Mir stehen permanent die Tränen in den Augen! Leute, bleibt, wie ihr seid! Vor allem: ganz doll gesund. Das ist das Allerwichtigste in dieser Zeit!«
In Dortmund war ein älterer Mann zu sehen, der an seinem Fenster stand, während eine türkische Menge vorbeilief. Er wirkte wie der strenge Schwabe, der das Geschehen von seinem Fenster aus beobachtet, um bei Missständen die Polizei wegen Ruhestörung zu alarmieren. Doch er streckte immer wieder die Hand aus, als wolle er das Geld in seiner Hand gegen eine Fahne tauschen. Sie gaben ihm die Fahne, und er feierte mit den Fans mit. Und sie jubelten gemeinsam.
Gemeinsam jubelten wir auch mit einem Saxophonisten, der zum Symbol dieses Sommermärchens schlechthin geworden ist. Auf seinem Kanal verbreitet er die Botschaft von Liebe und Zusammenhalt. Zu jedem Deutschlandspiel reiste er eigens zu den Fanmeilen, auf denen sich die deutsche Nationalmannschaft befand. Er brachte gute Laune mit, und die Leute feierten mit ihm. Schnell wurden die Medien auf ihn aufmerksam; sie hoben ihn in Dortmund auf eine Bühne, eine weite und leere Fläche, auf der er ziemlich verloren wirkte. Doch er sprang schnell herunter, tauchte unter und wurde wieder eins mit der ausgelassen feiernden Menge.
Diese EM hat dieses Land unfassbar zusammengeschweißt. Mehr noch: Diese EM hat den europäischen Geist geweckt, den ich schon so lange vermisst habe. Sie kam zu einer Zeit, in der wir uns alle gegenseitig die Köpfe eingeschlagen haben, weil die Meinung des einen nicht der Meinung des anderen entsprach. Es war endlich wieder so wie vor März 2020, der Zeit vor Corona. Eine unbeschwerte Leichtigkeit, wie ich sie lange nicht mehr gefühlt hatte. Erst Corona, dann der Ukraine-Krieg und die Inflation. Man hatte permanent das Gefühl, dass man keine Luft holen konnte – ein schreckliches Ereignis jagte das nächste. Die EM kam kurz nach den Wahlerfolgen der AfD, die sicherlich Ausdruck der Unzufriedenheit in diesem Land waren. Aber durch die EM konnte man all das vergessen. Jemand brachte es in einem Kommentar in den sozialen Medien auf den Punkt:
Wenn Politik und Medien schweigen, verstehen sich die Menschen plötzlich wieder.
Ein Schüler fragte mich, warum man nicht stolz auf sein Land sein dürfe. Ich antwortete ihm, dass man das durchaus kann. Es ist eine Frage der Identität. Ich betonte aber, dass es wichtig ist, dabei niemanden auszuschließen. Die EM hat gezeigt, wie es geht: Miteinander statt gegeneinander. All die zuvor geschilderten Ereignisse sind ein gelungenes Beispiel dafür. Bewahren wir uns diesen Gedanken, räumen unsere Vorbehalte beiseite und gehen wieder aufeinander zu statt aufeinander los. Gemeinsam schaffen wir mehr – die EM hat gezeigt, dass das geht.