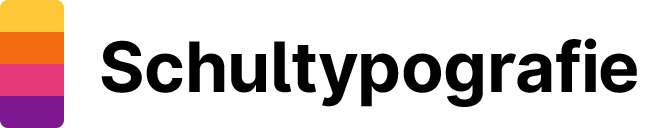Zu den Sternen
Manchmal genügt ein Blick in den Sternenhimmel, um die eigene Existenz neu zu bewerten. Zwischen Milliarden Galaxien, Lichtjahren der Leere und der Geburt und Vergänglichkeit der Sterne erscheinen Sorgen nichtig – und doch ist gerade diese Vergänglichkeit ein Anstoß, das Leben auszukosten.

Wir zogen oft um. In meiner späten Jugend besaß ich dann ein Zimmer mit einem Balkon zum Innenhof hinaus. Dorthin schlich ich mich in lauen Sommernächten, um auf dem Rücken liegend den weiten Sternenhimmel zu betrachten. So lag ich dann da, mit meinen Sorgen und Nöten – und vor mir die unendliche Weite des Universums mit all seinen Sternen und Galaxien.
Es heißt, dass das Licht unserer Sonne etwa acht Minuten benötigt, bis es die Erde erreicht. Zum Vergleich: Das Licht des nächstgelegenen Sterns, Proxima Centauri, benötigt etwa 4,3 Jahre, bis es unsere Netzhaut erreicht. Oder anders ausgedrückt: Dieser Stern ist 4,3 Lichtjahre von uns entfernt, und dazwischen befindet sich nichts als gähnende Leere. Dabei sind unsere Sonne und Proxima Centauri nur zwei von vielen Sternen in unserer Milchstraße. Man schätzt, dass es zwischen 100 und 400 Milliarden Sterne gibt – die genaue Zahl bleibt uns verborgen.
Nehmen wir als Mittelwert eine Anzahl von 250 Milliarden Sternen an: Würden wir nun jede Sekunde einen Stern abzählen, hätten wir nach 7.927 Jahren alle Sterne der Milchstraße gezählt. Doch unsere Milchstraße ist nur eine unter vielen weiteren, schier unzählbaren Galaxien. (Um genau zu sein: Es könnte zwei Billionen Galaxien geben und 2 × 10²³ Sterne, also 200 Sextillionen Sterne und mehr.) In diesem kosmischen Geflecht die Gesamtzahl aller Sterne zu schätzen, ist für unseren Verstand gar nicht mehr erfassbar.
Und es kommt noch dramatischer: Alles unterliegt einem Zyklus von Geburt, Leben und Tod. Sterne werden geboren, sie existieren eine Weile und sterben dann. Zunächst ist es eine Gaswolke, die sich verdichtet. Sie nimmt an Masse zu und – wie alles, das Masse hat – erzeugt sie Gravitation, die Anziehungskraft eines Körpers. Je mehr Masse ein Körper hat, desto stärker ist seine Gravitation.
In der Gaswolke verdichten sich nun die Gase. Es entsteht Masse – und damit auch Gravitation. Die Gase fallen zusammen und bilden, verkürzt gesagt, einen brennenden Gasball, den wir als „Stern“ bezeichnen. Was sich nun im Inneren des neugeborenen Sterns abspielt, ist ein komplexer Vorgang, den Wissenschaftler als „Kernfusion“ bezeichnen. Es ist eine feine Balance zwischen Explosion und Gravitation, die sich im Inneren eines Sterns vollzieht: Seine Masse möchte explodieren und sich im Weltall verteilen, doch sein eigenes Gewicht hält ihn zusammen. So lebt ein Stern vor sich hin – unsere Sonne schon seit 4,5 Milliarden Jahren.
Doch dieser Prozess kann nicht ewig dauern. Irgendwann hat jeder Stern seine Ressourcen verbraucht. Je nachdem, wie groß ein Stern ist, endet auch sein Leben. Unsere Sonne beispielsweise wird in fünf Milliarden Jahren ihr Gleichgewicht im Innern nicht mehr halten können, und die Expansionskräfte werden überhandnehmen. Dann wird sie sich aufblähen, dabei Merkur und Venus verschlucken und höchstwahrscheinlich kurz vor der Erde zum Stehen kommen – ein Roter Riese wird entstanden sein. In dieser Phase wird unsere Sonne ihre letzten Reserven verbrauchen, bis sie letztlich einen Teil ihrer äußeren Hülle abstößt und nur noch ein Weißer Zwerg zurückbleibt.
Dieser Weiße Zwerg ist durch seine Gravitation sehr kompakt in sich zusammengefallen und nicht sonderlich groß – aber könnte man einen Teelöffel von ihm abschöpfen, würde die abgeschöpfte Masse etwa fünf Tonnen wiegen. In diesem Stadium kühlt ein Weißer Zwerg langsam aus, bis von ihm nichts weiter als ein toter Schwarzer Zwerg übrig bleibt. Doch dies sind nur Vermutungen, da unser Universum noch nicht alt genug ist, als dass ein solcher Schwarzer Zwerg bereits hätte entstehen können.
Übrigens: Wäre die Sonne etwa 20- bis 25-mal größer, sähe ihr Sterbeprozess anders aus. Sie würde sich nicht als Roter Riese aufblähen, sondern in sich zusammenfallen und dabei die Masse so stark komprimieren, dass ihre Gravitation einen derart extremen Wert erreicht, dass nicht einmal mehr Licht reflektiert, sondern vollständig verschluckt wird. An dieser Stelle erscheint im Universum also ein lichtfreier Fleck – weshalb man diese Objekte als Schwarze Löcher bezeichnet.
In ihrer Umgebung verhält sich sogar die Zeit anders als um uns herum: Sie vergeht dort langsamer, während auf unserer Erde alles wie gewohnt weiterläuft. Schuld daran ist die immense Gravitation, die das Raum-Zeit-Gefüge krümmt und damit verändert. Der Entdecker dieser Erkenntnis war Albert Einstein, der dieses Phänomen als „Relativitätstheorie“ bezeichnete. „Relativ“ bedeutet grob übersetzt „in Bezug auf“ – in Bezug auf uns vergeht die Zeit eines Schwarzen Lochs langsamer, womit rein theoretisch sogar Zeitreisen in die Zukunft möglich werden.
Und so lag ich da auf meinem Rücken und versuchte, diese Komplexität unseres gigantischen Universums zu erfassen. In Bezug auf diese unendlichen Weiten, in Bezug auf diese verrückten Phänomene erschienen meine Probleme plötzlich nichtig und unwichtig. Und vieles wurde dadurch deutlich erträglicher – in meinem vergleichsweise kleinen, unbedeutenden Leben.
Wir machen uns so viele Gedanken um Dinge – wir fragen beispielsweise nicht nach dem überfälligen Date, wir wagen nicht den Sprung in ein anderes Berufsleben oder unternehmen nicht die Reisen, die wir längst hätten machen wollen. Auch unsere Lebenszeit ist begrenzt, und wir sollten sie ausgiebig auskosten, solange wir noch können. Damit man am Ende sagen kann: Dafür hat es sich gelohnt.